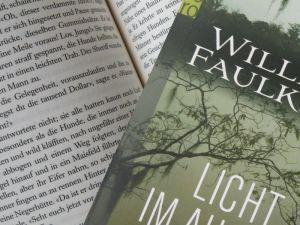valentino
Eine kurze Warnung vorweg: William Faulkners Buch Sartoris verstört und wirkt nach. Manche der Protagonisten sind lebensüberdrüssig oder sie folgen einer Todessehnsucht. Es gibt Schilderungen brutaler Gewalt, die Sprache ist derb, teils rassistisch. Wer es allerdings trotzdem liest, gewinnt einen tiefen Eindruck über das „Southern Gothic“-Genre.
Der Roman „Sartoris“ ist nach „Licht im August“ mein zweites Buch des US-Autors und Literatur-Nobelpreisträgers William Faulkner. Er handelt von vier Generationen einer Familie von Südstaaten-Aristokraten. Die Aristokratie befindet sich aufgrund der gesellschaftlichen Umbrüche in der Folge des Amerikanischen Bürgerkriegs im Niedergang. Das Buch erschien 1929 und stellt eine verkürzte Fassung des Werkes „Flags in the Dust“ dar, das posthum erstmals 1973 veröffentlicht wurde. Die Handlung spielt vor circa hundert Jahren, von 1919 bis 1920, also kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs.
Das Haus der Sartoris liegt vier Meilen entfernt von Jefferson, der fiktiven Kreisstadt des Yoknapatawpha County, einem fiktiven Landkreis im Nordwesten von Mississippi, 75 Meilen entfernt von Memphis, Tennessee. Dort liegt es in einem Tal, das ein Hügelland im Osten, das sogenannte Oberland, begrenzt. Es gibt eine Veranda mit einer Kolonnade. Das Haus ist still und hell und sieht einladend aus:
„Die weiße Einfachheit des Gebäudes träumte ungestört zwischen uralten Bäumen …“
(S. 12)
Heimkehr und Flucht
Das Buch besteht aus fünf Teilen mit jeweils zwei bis neun Kapiteln. Gegen Ende des ersten Teils kehrt der junge Bayard aus dem Krieg heim. Er und sein Zwillingsbruder John waren Kampfpiloten. Die Staffel eines Schülers von Manfred Richthofen hatte John im Jahr zuvor bei Lille mit seinem Flugzeug abgeschossen, was Johnny das Leben kostete. Drei Monate später starben auch Caroline, Bayards Frau, und ihr neugeborener Sohn. Auch seine Eltern sind bereits tot: seine Mutter Lucy und sein Vater John.
Nach seiner Heimkehr kauft er sich in Memphis ein Automobil und rast damit fortan durch den Landkreis. Auf diese Weise versucht er, die Trauer über die Verluste und seine Schuldgefühle – er erlebt Flashbacks von Johns Flugzeugabsturz – im Geschwindigkeitsrausch zu vergessen, oder er versucht sie durch andere waghalsige Handlungen zu verdrängen, etwa indem er betrunken einen ungezähmten Hengst reitet, mit dem er stürzt. Während sich das Pferd aufrappelt, bleibt Bayard mit einer Kopfverletzung liegen.
Nachdem Doc Loosh Peabody ihn mit einem Kopfverband und einem Schluck Whiskey versorgt hat, soll ihn Suratt, ein Agent, mit seinem Firmenwagen nach Hause bringen. Stattdessen fahren sie jedoch in Begleitung eines weiteren Jünglings (Hub) zu einer Quelle, wo sie zu dritt aus einem Krug Whiskey trinken:
„ (…) und die drei saßen in ihrer kleinen friedlichen Mulde, fern von Welt und Zeit und umhaucht von dem kühlen und reinen Atem der Quelle und vom Sintern des Sonnenlichts zwischen den Holunderbüschen und Weiden, das wie verdünnter Wein war. Auf der Fläche der Quelle spiegelte sich der Himmel, betupft mit reglosen Buchenblättern.“
(S. 140 f.)
Familie, Tradition, Gewalt
Dann ist da sein Großvater, der alte Bayard, ein schwerhöriger Bankier, der Dumas liest. Er macht nachmittags Reitausflüge auf dem Pferd in die Umgebung, wobei ihn sein alter Hund begleitet. Sein Vater, Oberst John Sartoris, war ein Bürgerkriegsheld und hatte einst die Eisenbahn gebaut. Er erschoss bei einem Streit über das Wahlrecht für Schwarze mit seinem dreiläufigen Derringer kurzerhand zwei Yankees in ihrem Quartier, als die beiden gerade an einem Tisch saßen, auf dem ihre Pistolen lagen. Ein gewisser Redlaw tötete ihn, als er unbewaffnet und seiner Vergehen überdrüssig war. Der Geist des Obersten liegt wie ein Schatten über dem Haus, seinen Bewohnern und der Umgebung.
Oberst John Sartoris hatte zwei jüngere Geschwister: Bayard und Virginia (Tante Jenny). Bayard starb 1862 im Alter von 23 Jahren im Amerikanischen Bürgerkrieg vor der zweiten Schlacht von Manassas (Schlachten von „Bull Run“) als Adjutant von Jeb Stuart in Virginia. Tante Jenny kam sieben Jahre nach dessen Tod aus Carolina. Sie erzählt die Geschichte von Bayards Tod bis ins hohe Alter, wobei sie sie immer mehr ausschmückt.
Tante Jenny sorgt dafür, dass Sheriff Buck den jungen Bayard über Nacht ins Gefängnis steckt, weil dieser, statt mit seiner Kopfwunde nach Hause zu kommen, bis spät in die Nacht mit Hub, Mitch, einem Frachtagenten, und drei schwarzen Musikern eine Spritztour zum Nachbarort gemacht hat.
Bevor der alte Bayard im Automobil seines Enkels mitfährt, holt ihn Simon Strother, der oberste Hausdiener, jeden Feierabend mit der Kutsche aus Jefferson von der Bank ab und bringt ihn nach Hause. Während der Fahrt führen beide lange Gespräche. Simons Sohn Caspey, auch ein Kriegsheimkehrer, war bei einem Arbeitsbataillon in Frankreich. Nach seiner Rückkehr ist er demoralisiert und hat sich in den Kopf gesetzt, sich von den Weißen nichts mehr sagen zu lassen. Eines Nachmittags kommt der alte Bayard nach Hause. Als er bemerkt, dass Tante Jenny mit seinem Enkel ausgefahren und sein Pferd noch nicht gesattelt ist, prügelt er kurzerhand den aufsässigen Caspey mit einem Stück Feuerholz auf den Kopf die Treppe hinunter. Simon sagt daraufhin zu seinem Sohn:
„Und du solltest lieber Gott danken, daß (sic) Er dir so’n harten Kopf gemacht hat. Jetzt gehste und holst (sic) das Pferd und überläßt (sic) denen in der Stadt das Geschwätz von Niggerfreiheit: die könnens vielleicht verkraften. Wozu solln wir Nigger uns überhaupt ne Freiheit wünschen, möcht ich wissen? Haben wir jetzt nich so viele Weiße, wie wir aushalten können?“
(S. 86)
Die Handgreiflichkeit gegen Caspey war eine Übersprunghandlung, denn eigentlich war es Isom, Caspeys 16-jährigem Neffen, vorbehalten, das Pferd zu satteln. Die Bemerkung des alten Bayard kurz darauf, er könne sein Pferd auch selbst satteln, wirkt da recht bigott.
Die Sklaverei der Kolonialzeit ist ein dunkler Fleck in der Geschichte der Südstaaten. Nach ihrer Abschaffung 1865 erodierte diese zwar als Institution, die Gleichstellung der Schwarzen blieb jedoch in der Zeit der sogenannten Rekonstruktion – und bis heute – unerreicht. Außerdem war Hand in Hand mit der wirtschaftlichen Ausbeutung der schwarzen Arbeitskraft auf der Plantage die „White Supremacy“-Ideologie entstanden: Weiße fühlten sich Schwarzen gegenüber „rassisch“ überlegen und erwarteten von ihnen absoluten Gehorsam. In der Folge wirkten sich die Machtverhältnisse auch auf die Beziehungen der Schwarzen untereinander aus: So fühlten sich zum Beispiel die von einer aristokratischen Südstaaten-Familie als Dienerschaft in dessen „erweiterten Kreis“ integrierten Schwarzen wiederum denjenigen überlegen, die auf den Feldern Baumwolle pflückten. Darüber hinaus gibt es in „Sartoris“ auch Gewalt innerhalb der Kernfamilie der Diener – so prügelt Simon, der eine Zeit lang Dekan der Baptisten-Kirche war, seinen Enkel Isom.
Der Fleck und das Herz
William Faulkner beschreibt den moralischen Verfall der Sartoris schonungslos. Obwohl alle Familienmitglieder roh sind, empfindet man gleichwohl Empathie mit ihnen, weil sie innerlich zerrissen sind. Die Handlung ist oft ironisch gebrochen oder tragikomisch, wofür exemplarisch die Geschichte von dem Fleck steht, den der alte Will Falls von der Armenfarm des Countys eines Tages an der Wange des alten Bayard entdeckt. Wer das Buch noch nicht kennt, sollte die folgende Textstelle überspringen, weil ab hier gespoilert wird.
Tante Jenny geht mit ihrem Neffen gegen dessen Willen zum jungen Doktor Alford. Dieser schlägt vor, die Geschwulst zu entfernen, doch Bayard weigert sich. Zu seinem Glück betritt in diesem Moment Loosh Peabody, der „dickste Mann im ganzen County“, die Praxis seines Kollegen. Nachdem er seine Brille aufgesetzt und die Stelle untersucht hat, nimmt er Bayard mit in seine Praxis, die sich gegenüber, hinter einer abgewetzten Tür, befindet. Dort will er dessen Herz abhören, weil er sich mehr um Bayards allgemeinen Gesundheitszustand sorgt als um die Geschwulst – zumal er davon erfahren hat, dass er im Automobil seines Enkels mitfährt:
„ (…) und er zog eine Schublade hervor und entnahm ihr eine Kiste Zigarren und eine Handvoll künstlicher Fliegen zum Forellenfischen und einen schmutzigen Kragen, und zuletzt brachte er ein Stethoskop zum Vorschein; dann warf er die übrigen Sachen wieder in die Schublade zurück und drückte sie mit seinem Knie zu.“
(S. 105)
Später behandelt der alte Falls die Stelle in Bayards Gesicht mit einer Salbe, die seine Großmutter vor 130 Jahren von einer Choctaw-Indianerin bekommen hatte und von der niemand weiß, welche Bestandteile sie hat. Angeblich soll die Geschwulst am neunten Tag im Juli abfallen. Nachdem sich Tante Jenny und der alte Bayard mehrere Tage lang jeden Abend gestritten haben, fahren sie zusammen mit Doktor Alford zu einem Spezialisten nach Memphis. Als der Spezialist gerade mit seinen Fingern die Stelle betasten will, fällt der, inzwischen von der Salbe geschwärzte, Auswuchs ab und es erscheint auf seiner „Wange eine runde Stelle rosig-heller Haut, wie bei einem Baby.“ (S. 240) Drei Wochen später erhalten die Sartoris die Rechnung des Spezialisten über fünfzig Dollar für dessen Behandlung.
Die Benbows, die MacCallums und die Snopes
Neben den Sartoris treten zahlreiche weitere Figuren auf, die ebenfalls alle sowohl verloren als auch leicht exzentrisch sind: Die Benbows sind allerdings ganz anders als die Sartoris und bilden deshalb einen willkommenen Kontrast.
Die 26-jährige Narcissa Benbow lebt mit ihrer etwas altmodischen Tante Sally Wyatt, die nicht blutsverwandt mit ihr ist, in einem im Tudorstil errichteten Haus in einer beschaulichen Gegend in Jefferson. Etwa nach der Hälfte der Erzählung kehrt ihr sieben Jahre älterer Bruder Horace, ein Anwalt mit einer Leidenschaft für die Glasbläserei, aus dem Krieg aus Europa heim, ohne sich dort an Kampfhandlungen beteiligt zu haben. Er hat eine Affäre mit der verheirateten Belle Mitchell, was zwischenzeitlich zu einer Entfremdung zwischen ihm und seiner Schwester führt. Julia, die Mutter der beiden, starb kurz vor ihrem Mann Will:
„Julia Benbow starb eines sanften Todes, als Narcissa sieben war, sie war aus dem Leben der Geschwister entfernt worden, wie man wohl ein Lavendelbeutelchen aus einem Wäscheschrank entfernt, und sie hinterließ eine zart verweilende Unfaßlichkeit, und als Narcissa heranwuchs, sieben und acht und neun Jahre alt wurde, schmeichelte sie den anderen beiden und beherrschte sie.“
(S. 180)
Narcissa und der junge Bayard können einander nicht ausstehen – ob sich da etwa eine Liebesbeziehung abzeichnet?
Dann sind da die MacCallums, sechs Brüder, die mit ihrem Vater in einem 18 Meilen entfernten Blockhaus in den Bergen leben, sechs Meilen von Mount Vernon, dem nächsten Dörfchen. Dort leben sie recht abgeschieden von der Jagd. Im besten Wortsinn könnte man sie etwas spöttisch als Hinterwäldler bezeichnen. Einige der Brüder tauchen manchmal in Jefferson auf. Die Zwillinge Bayard und John hatten vor einigen Jahren in ihren Ferien mit ihnen Füchse und Waschbären gejagt. Eines Tages im Winter gelangt der junge Bayard – auf der Flucht vor den Konsequenzen seiner Handlungen – durch die Fährte einer Füchsin mit seinem Pferd zufällig wieder zu ihnen.
Und dann gibt es da noch die Snopes. Eine seltsame Familie, dessen Mitglieder einer nach dem anderen aus Frenchman’s Bend, einer kleinen Siedlung im Oberland, nach Jefferson kamen und dort nun alle erdenklichen Gewerbe ausüben. Byron Snopes, der Buchhalter des alten Bayard, schickt Narcissa anonyme Briefe und stellt ihr heimlich nach – heute würde man ihn einen Stalker nennen. Dieser Handlungsstrang ist allerdings recht lose in die Erzählung eingeflochten.
Hoffnung
Der Roman verwebt virtuos Gegenwart und Vergangenheit. Die Handlung spielt manchmal leicht zeitversetzt oder es gibt Passagen, die entweder Versatzstücke aus der Erinnerung darstellen oder aus einer bestimmten Perspektive teils weit in der Vergangenheit liegende Ereignisse erzählen. So entsteht – sofern man sich auf Faulkners verschachtelt-filmischen Stil einlässt – ein dichtes Panorama des Landstrichs und seiner Figuren.
Für all jene, die sich näher mit Faulkners Werk beschäftigen wollen, sei in diesem Zusammenhang das Projekt DIGITAL Yoknapatawpha wärmstens empfohlen – dort findet man bei „Flags in the Dust“ auch eine Landkarte des Countys mit einer Visualisierung aller relevanten Schauplätze, Figuren und Ereignisse des Romans.
„Sartoris“ ist übrigens William Faulkners erster Roman, dessen Handlung in dem County spielt und bildet somit den Auftakt zu seinem Südstaaten-Romanzyklus. Das Wort „Yoknapatawpha“ entstammt der Sprache der Chickasaw-Indianer und bedeutet soviel wie „Fluss, der das Land teilt“.
Am Ende bringt Narcissa ihr Kind zur Welt. Sie gibt ihrem Sohn den Namen Benbow: Der erste Sartoris, der weder Bayard noch John heißt – wenn der Name nicht Programm und das mal kein Zeichen ist für den endgültigen Bruch mit der Tradition.
(c) valentino 2021
William Faulkner: Sartoris, Verlag Volk und Welt, Berlin 1988, 380 S.
Link zum Datensatz im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek